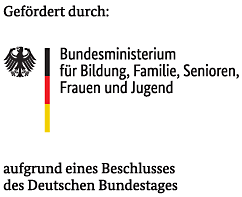07.01.2026
„Individuelle Wege bieten Chancen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“
Wie erreicht man Eltern mit Zuwanderungsgeschichte für eine klischeefreie Berufswahl? Uchenna Jonas macht im Interview mit der Initiative Klischeefrei Vertrauen, mehrsprachige Infos, Praxisnähe sowie starke Vorbilder und sichere digitale Räume als Erfolgsfaktoren aus.

Wie können Ihrer Erfahrung nach Eltern mit Zuwanderungsgeschichte am besten erreicht und einbezogen werden, wenn es um eine klischeefreie Berufsorientierung geht?
Aus meiner Sicht gelingt das am besten, wenn Schulen und Initiativen Eltern nicht nur „informieren“, sondern wirklich als Partner:innen einladen. Entscheidend sind dabei drei Dinge: Vertrauen, Zugänglichkeit und Praxisnähe. Vertrauen entsteht oft eher über persönliche Ansprechpersonen, Community-Strukturen oder Formate, die auf Augenhöhe stattfinden (zum Beispiel Elternabende mit Dialog statt Frontalvortrag). Zugänglichkeit heißt: Klare Sprache, gerne mehrsprachige Materialien, flexible Zeiten, niedrigschwellige Orte (Schule, Familienzentren, Moscheen/Kirchen/Synagogen/Vereine, Stadtteiltreffs).
Und Praxisnähe: Eltern wollen wissen, welche realen Chancen, sicheren Wege und Entwicklungsmöglichkeiten bestimmte Berufe bieten. Wenn klischeefreie Orientierung mit konkreten Informationen zu Ausbildung, Sicherheit, Verdienst, Perspektive und Anerkennung verbunden wird, steigt die Bereitschaft zum Mitgehen deutlich!
Wenn Sie an Geschlechterklischees in der Berufsorientierung denken: Erleben Sie, dass Eltern mit Zuwanderungsgeschichte das Thema anders angehen? Und wo sehen Sie Unterschiede innerhalb dieser sehr vielfältigen Gruppe?
Ich erlebe weniger ein „anders“, sondern eher ein „unter anderen Bedingungen“. Viele Eltern mit Zuwanderungsgeschichte handeln aus einem sehr nachvollziehbaren Sicherheitsbedürfnis heraus: Stabilität, gesellschaftliche Anerkennung, finanzielle Absicherung, Schutz vor Diskriminierung.
Das kann dazu führen, dass klassische Rollenbilder oder „bewährte“ Berufsbilder stärker betont werden. Gleichzeitig gibt es große Unterschiede innerhalb der Gruppe: Bildungsbiografie, Aufenthaltsstatus, Generation (selbst migriert versus in Deutschland aufgewachsen), Urbanität, soziale Lage, Sprache, Religiosität, individuelle Werte – all das prägt den Blick auf Geschlechterrollen und Berufsbilder. Deshalb ist es wichtig, nicht zu pauschalisieren, denn viele Eltern sind tatsächlich sehr offen, wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind ist sicher, wird ernst genommen, und dass die Entscheidung eine echte Perspektive hat.
Welche Veränderungen wünschen Sie sich im Bildungssystem oder Arbeitsmarkt, damit junge Menschen mit Migrationserfahrung und unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten gerechtere berufliche Chancen erhalten?
Ich wünsche mir vor allem mehr Struktur, mehr Schutz und mehr echte Teilhabe:
- Im Bildungssystem: Verpflichtende, qualitativ gute Berufsorientierung an allen Schulen – inklusive Antidiskriminierungskompetenz, diversitätssensibler Beratung und klaren Schutzkonzepten. Lehrkräfte und Berufsberater:innen sollten stärker darin geschult werden, eigene Bias zu erkennen, um junge Menschen nicht unbewusst in „typische“ Bahnen zu schieben.
- Im Übergang Schule-Beruf: Mehr Brückenformate, Mentoring, Praxiszugänge, bezahlte Praktika, mehr Sichtbarkeit nicht-traditioneller Vorbilder.
- Im Arbeitsmarkt: Konsequentere Maßnahmen gegen Diskriminierung im Bewerbungsprozess, mehr Transparenz bei Auswahlkriterien, sichere Beschwerdewege, queer- und rassismussensible Strukturen am Arbeitsplatz. Denn nicht nur der Zugang ist das Problem, sondern auch das Ankommen und Bleiben.
Inwiefern beeinflussen Migrationserfahrungen – eigene oder familiale – die Erwartungen an berufliche Wege von Mädchen und Jungen?
Migrationserfahrungen können Erwartungen stark prägen, weil sie oft mit Druck, Verlust, Neuanfang und dem Wunsch nach „Aufstieg“ verbunden sind. Manche Familien geben bewusst oder unbewusst die Botschaft weiter: „Du musst es schaffen, weil wir so viel aufgegeben haben.“
Dadurch werden Berufe, die als sicher, angesehen und „vernünftig“ gelten, besonders attraktiv. Gleichzeitig wirken gesellschaftliche Erfahrungen hinein: Wenn Eltern selbst Ausgrenzung erlebt haben, versuchen sie ihre Kinder oft zu schützen, zum Beispiel durch Anpassung. Geschlechterrollen können sich dabei verfestigen, weil sie Orientierung geben sollen. Aber auch hier: Das kann sich verändern, sobald Familien erleben, dass Vielfalt und individuelle Wege nicht Unsicherheit bedeuten, sondern echte Chancen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Welche Bedeutung haben Vorbilder aus Familie, Community oder Medien für die Berufsorientierung junger Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, und wie könnten solche Vorbilder gezielt gestärkt werden?
Vorbilder sind enorm wichtig, weil sie „Vorstellbarkeit“ schaffen. Wenn ich niemanden sehe, der so aussieht wie ich, so spricht wie ich, ähnliche Erfahrungen hat – dann wirkt ein Beruf schnell wie „nicht für mich“. Vorbilder aus Familie und Community geben Nähe und Glaubwürdigkeit. Medienvorbilder geben Reichweite und Inspiration. Gezielt stärken kann man das, indem man Role-Model-Programme ausbaut, Alumni-Netzwerke an Schulen etabliert, diverse Speaker:innen in die Berufsorientierung einlädt und nicht nur „Erfolgsgeschichten“ zeigt, sondern auch realistische Wege inklusive Umwege. Besonders kraftvoll ist es, wenn Jugendliche sehen: Es gibt Menschen, die Hürden hatten und trotzdem ihren Weg gefunden haben.
Welche Rolle spielen digitale Plattformen und Social Media bei der klischeefreien Berufsorientierung junger Menschen mit Migrationserfahrung – und wie können diese sicher und empowernd gestaltet werden?
Digitale Plattformen spielen eine riesige Rolle, weil sie für viele junge Menschen längst der Ort sind, an dem Orientierung passiert: über Inhalte, Creator:innen, Communities, Trends, aber auch über Vergleiche und Druck. Social Media kann empowern, weil Jugendliche dort Vorbilder finden, Perspektiven entdecken, Fragen stellen, sich vernetzen und Wissen niedrigschwellig erhalten. Gleichzeitig ist es ein Raum, in dem Desinformation, Rollenklischees, Rassismus, Sexismus oder Queerfeindlichkeit sehr präsent sein können.
„Sicher und empowernd“ wird es aus meiner Sicht dann, wenn wir Medienkompetenz nicht nur als Technikthema behandeln, sondern als Schutz- und Identitätsthema: Wie erkenne ich manipulative Inhalte? Wie setze ich Grenzen? Wie schütze ich meine Daten? Wie gehe ich mit Hate um? Dazu braucht es auch Erwachsene, die digitale Räume nicht abwerten, sondern verstehen und begleiten. Empowernd wirkt Social Media außerdem, wenn gezielt diverse, klischeefreie Bildungsinhalte gefördert werden. zum Beispiel durch kuratierte Empfehlungen, Kooperationen mit Creator:innen, die sensibel arbeiten, und durch Formate, die nicht nur Berufe vorstellen, sondern auch Selbstvertrauen, Sprache für Grenzen und Resilienz stärken.