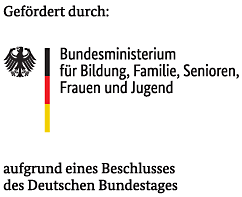14.07.2025 | Margit von Kuhlmann
„Kinder brauchen Gelegenheit, Berufe erleben zu können“
Interview mit Dr. Lara Altenstädter, Soziologin an der Universität Duisburg-Essen
Geschlechtergleichstellung im Wissenschaftsbetrieb ist ein Schwerpunktthema der Arbeit von Dr. Lara Altenstädter. Schon Grundschulkinder ordnen unbewusst Berufe Männern oder Frauen zu, auch den Beruf „Forscherin/Forscher“. Eine Lösung: Eine frühere und vor allem geschlechtersensible berufliche Orientierung.

Dies ist eine gekürzte Fassung des Textes.
Das komplette Interview finden Sie in der Infothek.
Frau Dr. Altenstädter, Sie forschen unter anderem zu Geschlechterungleichheiten in der Wissenschaft. In Universitäten, aber auch in der Wirtschaft, hört man die Aussage: „Positionen werden bei uns nach Leistung besetzt, nicht nach Geschlecht“. Das erklärt die Gender Gaps jedoch nicht. Mehr Mädchen als Jungen eines Jahrgangs machen Abitur und studieren. Trotz dieser Leistungsorientierung der Frauen gehen Professuren noch immer häufig an Männer. Was sind die Ursachen?
Diese vermeintlich geschlechtsneutrale Leistungsorientierung – die sogenannte Bestenauswahl – ist ein zentrales Narrativ im Wissenschaftssystem. Der Satz „Positionen werden bei uns nach Leistung besetzt“ blendet zwei Dinge aus: erstens, dass Leistungen immer kontextabhängig sind. Das heißt, gute Arbeitsbedingungen, ein unterstützendes soziales Umfeld und günstige Herkunftsbedingungen beeinflussen, welche Leistungen jemand erbringen kann. Und zweitens ist wissenschaftliche Exzellenz weder objektiv messbar, noch wird diese neutral oder geschlechtsunabhängig bewertet. Vielmehr ist wissenschaftliche Exzellenz eine konstruierte Vorstellung und wird an Kriterien gemessen, die von Menschen mit Macht und Einfluss (im Wissenschaftssystem, historisch bedingt, immer noch überwiegend Männer) festgelegt wurden.
Unsere Forschungen im EXENKO-Projekt „Exzellenz entdecken und kommunizieren“– gemeinsam mit meinen Kolleginnen Prof. Ute Klammer, Dr. Maren A. Jochimsen und Eva Wegrzyn – zeigen deutlich: Die Zuschreibung von Exzellenz ist in hohem Maße durch soziale und kulturelle Erwartungen geprägt – und damit auch durch Geschlechterstereotype beeinflusst.
Es greift zu kurz nur auf individuelle Leistung zu schauen. Wir brauchen strukturelle Veränderungen in Hochschulen – etwa eine reflexive Betrachtung der wissenschaftlichen Exzellenzkriterien, gezielte Förderung der medialen Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen und eine geschlechtersensible Wissenschaftskommunikation. Erst wenn wir Leistungen kontextualisieren und die bestehenden Anerkennungsstrukturen kritisch hinterfragen, können wir die Geschlechterungleichheit im Wissenschaftssystem wirksam adressieren.
Geschlechterklischees setzen sich schon in der frühen Kindheit in den Köpfen fest. Sie selbst haben im Rahmen einer Studie Grundschulkinder gebeten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu malen. Welche Erkenntnisse konnten Sie daraus ziehen?
Tatsächlich prägen sich Geschlechterbilder und Vorstellungen von Wissenschaft sehr früh – oft unbewusst und vermittelt durch Medien, Schule und Alltag. In meiner qualitativen Forschungsarbeit habe ich elf Grundschulkinder, deren Mütter in der Wissenschaft tätig sind, gebeten: „Zeichne eine forschende Person.“ Dabei wollte ich herausfinden, welche inneren Bilder von Wissenschaft und Forschenden in den Köpfen der Kinder existieren – und ob sich durch die familiäre Nähe zu einer Wissenschaftlerin stereotype Vorstellungen verändern.
Dies scheint tatsächlich so zu sein, denn sechs von elf Zeichnungen zeigten weibliche Forschende – teils mit der klaren Aussage „Das bist du, Mama“. Das ist insofern bedeutsam, als klassische Studien wie der „Draw-A-Scientist“-Test seit Jahrzehnten nachweisen, dass Kinder häufig stereotype Bilder von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zeichnen – also öfter ältere Männer mit Kittel, Brille und Reagenzglas. In meinen Daten wurden diese Vorstellungen zumindest teilweise aufgebrochen, was auf den Einfluss direkter weiblicher Rollenvorbilder hinweist.
Nur wenn wir Kindern zeigen, dass eine forschende Person auch eine Frau in Jeans auf einer Ausgrabung oder am Laptop sein kann – und nicht nur ein Mann im weißen Kittel – schaffen wir die Grundlage für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft der Zukunft.