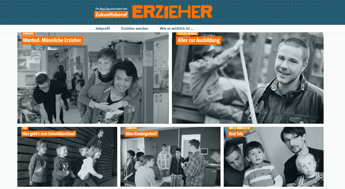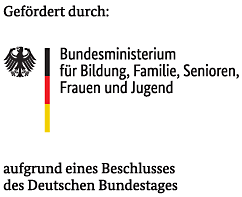Vaclav Demling
Was hat Frühe Bildung mit Berufswahl zu tun? Eine Einführung.
Der Berufs- oder Studienwahl geht normalerweise ein mehrere Jahre andauernder Orientierungsprozess voraus. In diesen Prozess fließt vieles ein: Vorbilder im Umfeld, die Meinung der Eltern, der Lehrerinnen und Lehrer und des Freundeskreises, das lokale Ausbildungsplatzangebot, aber vor allem auch das Geschlecht. Doch sollten nicht die eigenen Stärken und Interessen die Berufswahl bestimmen, unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit?

Viele Jugendliche verbinden einen Großteil der Berufe mit bestimmten Vorstellungen, die sie im Laufe der Kindheit gewonnen haben. Dazu gehört, dass die meisten Berufe mit einem bestimmten Geschlecht in Verbindung gebracht werden. So sind Berufe im Handwerk, in der Industrie oder in der Landwirtschaft männlich konnotiert, Erziehungs-, Bildungs- und Pflegeberufe hingegen weiblich. Dies führt vielfach dazu, dass junge Menschen viele Berufe und zum Teil ganze Berufszweige von vornherein für sich ausschließen, weil sie – den Klischees entsprechend – nicht dem entsprechenden Geschlecht angehören. Auch wenn viele junge Menschen noch gar nicht genau wissen, welchen beruflichen Weg sie später mal einschlagen möchten, schließen sie so viele berufliche Möglichkeiten für sich von vornherein aus. Hinzu kommt ein oft nur lückenhaftes Wissen über die Vielfalt der Ausbildungsberufe und Studiengänge.
Zwar unterstützen Berufsorientierungskonzepte an Schulen und die Aktivitäten der Arbeitsagenturen, der Kammern und Hochschulen Jugendliche darin, ihre Berufswege zu finden. Die Statistiken zeigen jedoch, dass die Geschlechtszugehörigkeit nach wie vor ein sehr bestimmender Faktor bei der Berufs- und Studienwahl ist, dem nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Berufsfindung findet demnach nicht unvoreingenommen statt, da Jugendliche bereits viele Sozialisationsprozesse durchlaufen haben, die dazu führen, dass die Berufsorientierung klischeebehaftet und nicht selten von Geschlechtsstereotypen geprägt ist.
Berufsbilder in der Kindheit
Während der formalisierte Berufswahlprozess im Alter von ca. 13–18 Jahren stattfindet, entwickeln Kinder schon sehr früh individuelle, subjektive Berufsbilder und Berufsfantasien. Die Entstehung dieser Bilder wird geprägt vom Elternhaus, vom gesellschaftlichen Milieu, von der Kindertagesstätte, der Gruppe der gleichaltrigen Kinder und später der Grundschule. Nicht zuletzt üben Medien – Bücher, Filme, Serien, Spiele etc. – einen großen Einfluss auf kindliche Berufsvorstellungen aus. All diese Einflussfaktoren sind in der Regel hochgradig mit Geschlechterklischees verknüpft und legen Mädchen und Jungen häufig verschiedene berufliche Optionen nah.
Erwachsene, die Jugendliche bei der Berufswahl unterstützen oder begleiten, stehen vor der Herausforderung, dass sie jungen Menschen Orientierung in einer Phase geben sollen, in der viele von ihnen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit bereits einengende Vorstellungen haben.
Der Berufswahlprozess benötigt jedoch eine Offenheit im Blick auf die eigene berufliche Zukunft. Junge Menschen sollten ihre persönlichen Stärken, Potenzialen und Talente als Maßstab für ihre Berufswahl nehmen und sich nicht von Erwartungshaltungen oder Geschlechterklischees leiten lassen. Denn: Wenn sich Menschen beruflich selbst verwirklichen können, profitiert das Individuum, die Wirtschaft und nicht zuletzt die Gesellschaft.
Berufsorientierung in der Kindertagesstätte?
Setzt also die Berufsorientierung mit ersten Maßnahmen in weiterführenden Schulen zu spät an? Nicht unbedingt. Oder anders gesagt: Berufsorientierungsunterricht ab Klasse 1 oder gar in der Kita ist sicherlich nicht zielführend. Notwendig ist allerdings eine klischeefreie Offenheit auf Seiten der Kinder und der Erwachsenen, wenn die Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1 beginnt.
Diese Offenheit kann auch dadurch erreicht werden, dass Geschlechterklischees in der Frühen Bildung kindgerecht thematisiert und Kinder ermutigt werden, sich vielseitig auszuprobieren. Wenn Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer Kindern zeigen, wie vielfältig Menschen und ihre Lebenswege sind und wie sich diese Vielfalt auch im Berufsleben widerspiegelt, bestärken sie Kinder, ihren Interessen nachzugehen und ihre individuellen Neigungen, Stärken und Talente unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit zu entdecken.
Voraussetzung dafür ist, dass die Erwachsenen im Umfeld der Kinder sich der Klischees und auch ihrer eigenen Vorurteile bewusst sind und sie kritisch reflektieren. Wir alle reproduzieren bewusst und unbewusst Geschlechterklischees und tragen sie an Kinder heran, die diese Stereotype verinnerlichen und sich an ihnen orientieren.






-Heidi-Scherm,-Stiftung-Haus-der-kleinen-Forscher-lpr_280x153.jpg)
OliverKepka_280x153.jpg)